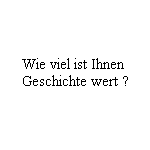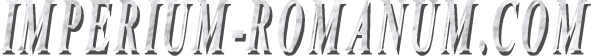
Version LX
GEOGRAFIE
Provinzen

![]() GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
![]() VORGESCHICHTE
VORGESCHICHTE
![]() EROBERUNG
EROBERUNG
![]() VERWALTUNG
VERWALTUNG
![]() MILITÄR
MILITÄR
![]() WIRTSCHAFT
WIRTSCHAFT
![]() RELIGION
RELIGION
![]() SPÄTANTIKE
SPÄTANTIKE
![]() NACHFOLGER
NACHFOLGER
zurück zu den
germanischen Provinzen
Eroberung & Sicherung
Bei
seiner Eroberung gehörte Niedergermanien zu Gallien. Caesar hatte die
grosse Provinz zwischen 58 und 51 v.Chr. erobert. Im nordöstlichen
Gebiet machten ihm die Sueben zu schaffen, die auf der Suche nach
geeigneten Siedlungsgebieten über den Rhein eingedrungen waren. Mehr
als einmal musste Caesar den Fluss überqueren. Berühmt sind seine Brückenschläge
der Jahre 55 und 53 v.Chr. im Neuwieder Becken. Beide Feldzüge wurden
abgebrochen noch bevor der Gegner endgültig besiegt werden konnte.
Die Gründe dafür lagen in Rom, in dessen Politik Caesar ständig
einzugreifen gedachte um nicht Pompeius oder Cato die Macht zufallen
zu lassen.
Für
die Römer bildete der Rhein sowohl sprachlich als auch kulturell die
natürliche Grenze zwischen den keltischen Galliern und den Germanen.
Caesar war der erste, der die Unterschiede in beiden Kulturen
hervorhob. Doch auch er wusste bereits, dass eine vollkommene Trennung
nicht möglich war. Starke germanische Kontingente, wie die Eburonen,
hatten schon lange linksrheinische Gebiete bewohnt. Sie bildeten immer
einen Quell der Unruhe und Caesar befürchtete, sie könnten sich mit
den benachbarten Galliern gemeinsame Sache machen. Die Ausrottung der
germanischen Völkerschaften links des Rheins war deshalb ein
Anliegen, dass Caesar mit besonderer Brutalität verfolgte. Sogar im
Senat in Rom war man ob dieses Genozids beunruhigt. Cato selbst hat
einen Antrag auf Auslieferung Caesars an die Germanen eingebracht.
Caesar
hatte von Anfang an vor, den römischen Machtbereich am Rhein enden zu
lassen. Flüsse waren im geistig-religiösen Verständnis der Römer
die idealen Grenzen. Auch politisch liessen sich die Kämpfe mit den
Germanen links und rechts des Rheins perfekt ausnutzen in einer Zeit,
da Pompeius im Osten des Reiches glorreiche Siege errang. Das Gebiet
zwischen dem echten Gallien und dem Rhein sollte somit eine Pufferzone
gegen eventuelle germanische Einfälle bilden. Erst Augustus richtete
seine Augen bis an die Elbe.
Die
letzten Widerstände wurde mit der Niederringung des Aufstandes von
Vercingetorix 52/51 v.Chr. gebrochen. Die Gallier fügten sich der überlegenen
römischen Militärmacht und assimilierten sich schnell in der neuen
Kultur.
Das
Grenzland hingegen blieb ausserhalb des überaus erfolgreichen
Gesamtkonzeptes für Gallien. Es bildete ein Anhängsel, vergleichbar
mit den frühmittelalterlichen Marken. Sieht man von Augustus und
Marcus Aurelius ab, so blieb Rom an Rhein und oberer Donau immer in
der Defensive. Das fehlende politische Konzept führte zu einer Kluft
zwischen den Stämmen und hat schlussendlich zur Niederlage im
Teuteburger Wald geführt.
Die
Differenzen lagen vor allem im zivilisatorischen und psychologischen
Bereich. Die Germanenstämme waren bei weitem nicht so homogen
organisiert wie die Kelten. Es gab zwischen ihnen bedeutende
kulturelle Entwicklungsunterschiede, vor allem nach Nord und Ost. Die
linksrheinischen Germanen waren seit geraumer Zeit keltisiert worden.
Im Mündungsgebiet des Rheins spürte man hingegen kaum etwas davon.
Das Kulturgefälle entlang des Rheins machten sich die Römer
schliesslich selbst. In rasanter Weise entwickelte sich ein Gefälle
zwischen den rasch romanisierten Menschen links des Rheins und den
traditionsbewussten Germanen diesseits des Flusses. Die Kluft ging
durch zahlreiche Familien und erschwerte die Beziehungen enorm.
Die
Germanen bildeten den Bürgerschreck der ersten nachchristlichen
Jahrhunderte, denn sie hatten es geschafft (erstmals die Kimbern &
Teutonen) das römische Selbstwertgefühl anzukratzen. Beutezüge
einzelner Stämme blieben beinahe an der Tagesordnung und 17 oder 16
v.Chr. gelang den Sugambrern die Erbeutung eines Legionsadlers. Eine
Schande für das römische Volk. Aber selbst dies verblasste hinter
dem wahr gewordenen Schreckensszenario der Varusschlacht mit seinen
20.000 Toten und 3 verloren gegangenen Feldzeichen. Auch aus diesem
psychologischen Dilemma ist die Germanenpolitik, die eigentlich keine
war, zu verstehen.
Lediglich
Augustus bemühte sich um eine langfristige Lösung.
Wahrscheinlich im Zeichen
der Niederlage des Statthalters Lollius 17 oder 16 v.Chr. liess er
wohl von Agrippa, der 39/38 und 20/19 v.Chr. Statthalter Galliens war,
ein Konzept zur Eingliederung der Germanen in den römischen
Staatsverband ausarbeiten. Ziel war nun die Elbgrenze. Mit dem Tod
Agrippas 12 v.Chr. ging die Leitung der Unternehmung auf Augustus’
Stiefsohn Drusus über. Gut dreissig Jahre sollte die
Auseinandersetzung dauern und niemals zu einer direkten Herrschaft führen.
Nachdem
Drusus 9 v.Chr. verunfallt war, kam das Kommando auf Tiberius, der in
die Fussstapfen seines Bruders trat. Er setzte vor allem auf
Verhandlung und Organisation, wusste aber auch mit aller Härte
durchzugreifen. Die Sugambrer, ein Stamm der stets bei allen Unruhen
an vorderster Front kämpfte, wurde von der politischen Landkarte
getilgt; die kümmerlichen Reste links des Rheins angesiedelt.
Von
6 v.Chr. bis 4 n.Chr. herrschte weitgehend Ruhe an der Grenze und nur
einmal begab sich Tiberius bis an die Elbe. Dann begann wieder eine
Saison der Feldzüge und zahlreiche Stämme machten Bekanntschaft mit
römischem Stahl. Im Jahre 6 n.Chr. galt das Gebiet als
„befriedet“. Man machte sich bereits Hoffnung in späteren Jahren
kräftig Tribut kassieren zu können.
Das
Jahr 9 brachte aber die Wende. Tiberius’ Nachfolger Publius
Qinctilius Varus handelte bereits als Statthalter und schoss bei der
Organisation der neuen Provinz beträchtlich über das Ziel. Als
Verwaltungsfachmann ging er von einer vollständig befriedeten Provinz
aus. Der Aufstand des Arminius überraschte die Römer und nach der
Ausradierung dreier Legionen stand das Imperium unter Schock. Schon
sah man die barbarischen Horden - die gerade noch als loyale
Untertanen eingestuft worden waren - in Gallien einfallen. Doch eine
Folgekatastrophe blieb aus, was den lokalen Charakter des Aufstandes
bezeugt.
In
den folgenden Jahren sicherte Tiberius die Rheingrenze und liess sich
durch Germanicus die Legionsadler wiederbeschaffen. Der Kaiser
verfolgte nun wieder eine reine Grenzsicherungspolitik und überliess das
Gebiet den Zwistigkeiten der Stämme untereinander. Neu war die
Schaffung eines Niemandslandes rechterseits des Rheins um bei
drohenden Überfällen ein besseres Aufmarschgebiet zu haben. Aber
nicht alles rechtsrheinische Gebiet war verloren gegangen. Das Friesenland blieb bis in die Zeit von Kaiser
Claudius
unter römischer Hoheit.
Unter
diesen Eindrücken machte die Germanisierung Niedergermaniens, aber
auch des angrenzenden Belgiens nur geringe Fortschritte. Und kaum als
die römische Militärpräsenz im Frühjahr 69 einmal nachgelassen
hatte, nutzten dies zahlreiche Stämme zum Aufstand. Nach dem Abzug
von 60.000 Mann in Richtung Italien durch Aulus Vitellius war
praktisch kein Grenzschutz mehr gegeben. Nach kurzer Zeit waren alle
Lager vom Mittelrhein bis an die Küste überrannt.
Zunächst
tarnte sich der Führer des Aufstandes, Iulius Civilis, als
Gefolgsmann Vespasians, doch nach dem Tod von
Vitellius wurden seine
wahren Absichten ruchbar. Er wollte ein eigenständiges Imperium
Germaniarum et Galliarum schaffen. Im Jahre 70 trafen sich die
Stammesführer in Agrippina (Köln/D) und berieten über das weitere
Vorgehen. Man überschätzte allerdings die eigenen militärischen Kräfte
und nachdem Vespasian sich im Reich Respekt verschafft hatte, brach
der Aufstand in sich zusammen.
Der
darauf folgende massvolle Friede entsprach wieder dem Geiste des Tiberius und
Vespasian kümmerte sich rein um die Sicherung der Grenze. Man liess
die Waffen nur dann sprechen, wenn die Diplomatie versagte. Mit ein
Grund dafür war die Sparsamkeit des neuen Kaisers; denn Kriegführen
kostete eine Menge Geld. Vespasian tauschte nach und nach die
Truppenkontingente aus und sicherte sich so die Loyalität der
Soldaten. Diese Ordnung sollte bis ins 3.Jh.n.Chr. massgeblich
bleiben. Niedergermanien erlebte eine 200jährige Friedenszeit, die
erst durch den Ansturm der Franken unter Valerian beendet wurde.

Kaiser
Augustus bemühte sich um eine langfristige Lösung des
"germanischen Problems".
Sie wollen Fragen stellen, Anregungen
liefern oder sich beschweren?
Dann klicken Sie auf meine Kontaktseite!
(PL)