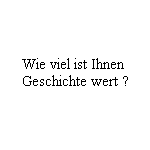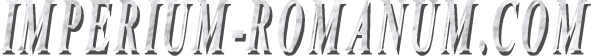
Version LX
GEOGRAFIE
Provinzen

![]() GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
![]() VORGESCHICHTE
VORGESCHICHTE
![]() EROBERUNG
EROBERUNG
![]() VERWALTUNG
VERWALTUNG
![]() MILITÄR
MILITÄR
![]() WIRTSCHAFT
WIRTSCHAFT
![]() RELIGION
RELIGION
![]() SPÄTANTIKE
SPÄTANTIKE
![]() NACHFOLGER
NACHFOLGER
zurück zu den
germanischen Provinzen
Wirtschaft & Gesellschaft
Gepflasterte
Strassen waren in Untergermanien auf Städte wie Agrippina
(Köln/D)
beschränkt. Die Überlandstrassen entsprachen dem allgemeinen
Standard römischer Strassenbaukunst. Sie waren geschottert, in der
Mitte aufgewölbt und teilweise auf einem bis zu 1 m hohen Fahrdamm
angelegt. Am Rand waren dann noch Treppelwege angebracht, auf denen
etwa Herden getrieben wurden.
Neben
der römischen Meile wurde auch die gallische Leuga (2,22 km = 1,5
Meilen) als Streckenmass verwendet, die sich seit Septimius Severus
endgültig in dieser Provinz durchsetzte. Ausgangspunkt für die
Berechnungen der Meilensteine war meist Agrippina (Köln/D). Die meisten
erhalten gebliebenen Meilensteine fanden sich an der Strasse nach
Augusta Treverorum (Trier/D); fast alle zählten nach Leugen. Ab und zu
wurden auch 1000 Doppelschritte angegeben. So etwa auf einer Säule
des Marcus Aurelius und des
Lucius Verus aus dem Jahre 162, wo steht:
A COL AGRIPP M P XXXIX (39.000 Doppelschritte von Colonia
Agrippina).
Eine Rarität stellt ein achteckiger Leugenstein aus schwarzem Basalt
da, dessen Reste man 1817 ergraben hat. Er listet alle Routen auf, die
von Advatuca Tungrorum ausgingen; nennt dabei Zielpunkte und
Entfernungen.
Die
Strassen wurden von zahlreichen Begleitbauten gesäumt, von denen
jedoch nur sehr wenige ausgegraben werden konnten. Eine Statio samt
Horreum (Getreidespeicher; hier für die Ablieferung für
Naturalabgaben) ist bei Advatuca Tungrorum gefunden worden. Brücken
sind sowohl inschriftlich als auch archäologisch bekannt. Das grösste
derartige Bauwerk war die Rheinbrücke zwischen Agrippina
(Köln/D) und
Divitia (Köln-Deutz/D) mit über 400 m Länge und ca. 10 m Breite. Im
Gegensatz zu allen anderen Brücken in Untergermanien, die aus Holz
erbaut worden waren, bestand diese aus 19 Steinpfeilern mit hölzernem
Oberbau. Erbaut wurde sie unter Kaiser Konstantin 336. Die Bauzeit
zuvor betrug mehrere Jahrzehnte.
Die
Wasserwege der Provinz hatten überragende Bedeutung, da die
Frachtkosten zulande mehr als die Hälfte des Warenwertes ausmachen
konnten. Uferbefestigungen und Kaianlagen wurden zahlreich ergraben
und Treppelwege ausgemacht. Untergermanien hatte den Vorteil nicht nur
über ein dichtes Flussverkehrsnetz, sondern auch Anschluss ans Meer
zu besitzen. Die eindrucksvollste Kaianlage wurde bei Xanten
freigelegt, wo sich einstmals ein schiffbarer Rheinarm befand. Der
Hafen versorgte seit etwa dem Jahre 80 n.Chr. die Cugerni-Siedlungen.
Wasserleitungen
sind bislang nur für Traiana (Xanten/D) und Agrippina
(Köln/D)
nachgewiesen. Am bekanntesten ist die Eifelwasserleitung von den
Bergen der Voreifel nach Agrippina (Köln) durch ihre Länge von mehr
als 100 km. Sie konnte bis zu 20.000 m³ Quellwasser pro Tag
transportieren.

Eifelwasserleitung
mit Einstiegsschacht bei Mechernich-Breitenbenden
e libro (habe ich mir leider nicht vermerkt...)
Aus
wirtschaftlicher Sicht galt Untergermanien als entwicklungsfähiges
Land an der Grenze. Gegenüber dem freien Germanien (wo nur der Handel
als gewinnbringend galt) hatte es den Vorteil, dass sowohl Bodenschätze
(wie Trachyt u.a. Steine) als auch Landwirtschaft und Viehzucht
vorhanden waren. Plinius lobte etwa die Ubier für ihre Ackerbaukunst
sowie die zahlreichen germanischen Gänse (Daunenproduktion).
Zu
Beginn musste noch vieles importiert werden, da die Siedlungen und
Militärlager schneller wuchsen als die lokale Wirtschaft. Die Abhängigkeit
von Gallien und Italien dürfte dann aber der Ansporn gewesen sein,
den Bedarf aus eigener Produktion zu decken. Dies ging mit dem Ausbau
der Verkehrswege einher. Nicht einmal ein Jahrhundert wurde benötigt,
um die Importe massgeblich zurückzudrängen. In bescheidenem Umfang
konnte sogar exportiert werden. Qualitätsprodukte wurden zwar nach
wie vor importiert, doch konnten die lokalen Handwerker billiger
produzieren und Waren aus Italien und entfernten gallischen Städten
waren schon alleine der Frachtraten wegen teurer.
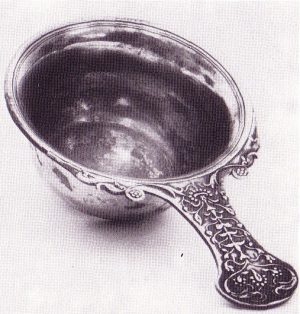
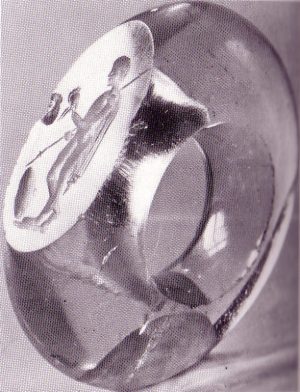
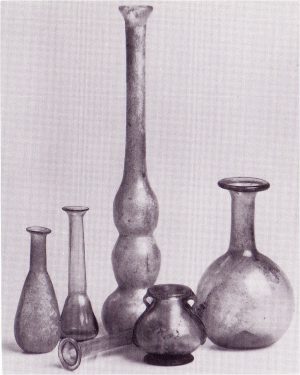
links: silberne
Kasserolle, Neuss, 1.Jh.n.Chr.
Mitte: Siegelring aus Bergkristall mit Bild des Mars, Neuss,
2./3.Jh.Chr.
rechts: Duftölfläschchen, Grabbeigaben, 1.Jh.n.Chr.
e libro [habe ich mir leider nicht vermerkt...]
Ein
wichtiger Bodenschatz war Blei, das im Auftrag des Statthalters durch
die legio XVI und legio
XIX gewonnen wurde. Zentren des Abbaus lagen
zwischen Kommern, Mechernich und Keldenich in der Nordeifel. Auch
beiderseits der Rur wurde fleissig geschürft. In der Nordeifel wurden
zudem Rot- und Brauneisenstein im Tagebauverfahren gewonnen. Kupfer
gab es in der Provinz keines, jedoch lagen Vorkommen rechts des Rheins
bei Rheinbreitbach, wo Spuren römischen Abbaus gefunden wurden.
Steinkohle gewann man zwischen Aaachen und Eschweiler. Die Kohle wurde
einerseits in den Häusern verheizt, andererseits zum Aufkohlen des
Eisens verwendet. Der Goldbergbau spielte nur eine geringe Rolle, etwa
in der Hohen Venn westlich von Monschau/Eifel. Wichtiger war wohl das
Rheingold, der schon damals als aurifer (goldtragend) galt.
Die
Bauwirtschaft entwickelte für Untergermanien völlig neue Berufe, wie
Architectus (Baumeister) und Lapidarius (Steinmetz). Da anfangs noch
keine Fachkräfte vor Ort zur Verfügung standen, zogen in den ersten
Jahrzehnten zahlreiche Gallier zu, die bereits das hohe Niveau römischer
Bau- und Mosaikkunst beherrschten.
Die
wichtigsten Baumaterialien (Grauwacke, Basalt, Trachyt und Tuff)
wurden allesamt im Süden der Provinz gebrochen. Eine Ausnahme bildete
der für Bauzwecke kaum verwendbare Kalksandstein am Liedberg bei Mönchengladbach.
Das grobe Sedimentgestein Grauwacke fand man in der Nähe der
Provinzhauptstadt gleich am Flussufer und wurde in grossen Mengen
verschifft. Leicht gewinnbarer Säulenbasalt wurde in der
Mittelrheinregion sowohl linkerseits als auch rechterseits des Rheins
abgebaut. Das Vulkangestein Trachyt brach man am Drachenfels und am Rüdenet
bei Königswinter. Das meistverwendete Baumaterial war Tuffgestein,
welches im Brohltal und in der Pellenz nördlich und südlich des
Laacher Sees in rauen Mengen gewonnen wurde. Importware bildete
Jurakalkstein (beliebt wegen seines hellen und warmen Farbtons) aus
der Gegend südlich von Metz und natürlich Marmor, der aus allen
Winkeln des Reiches bezogen wurde.
Auch
an anderen Baumaterialien wie Holz, Kies und Sand bestand kein Mangel.
In der Nordeifel gab und gibt es grosse Dolomitbänke, die eine
industrielle Kalkgewinnung rentabel machten. 1966-69 wurde eine ganze
Calcaria (Kalkfabrik) ergraben und einer der Öfen konnte erfolgreich
in Betrieb genommen werden. In der Antike werkten zahlreiche Calcarii
(Kalkbrenner), angehende Baumeister und Soldaten unter der Leitung
eines Magister calcariorum (Brennmeister).
Bekanntlich
mauerten die Römer gerne mit Ziegeln und wie überall anders auch
standen die grössten Tegularia (Ziegeleien) unter militärischer Führung.
Neben den Legionsstandorten lag ein wichtiges Produktionszentrum auf
dem Holdeurn südöstlich von Nijmegen/NL. Überwacht wurden die
Arbeiten meist von einem Magister Figulorum (Töpfermeister). Neben
den Ziegeleien für die Grossbauten hatten auch viele Villen auf dem
Lande ihr eigenen Hausziegeleien. Über die ganze Provinz verstreut
fand man auch ganze Töpfereibezirke. In Coriovallum (Heerlen/NL) fand
man ein ganzes Töpferdorf, das Gebrauchsgeschirr für die Umgebung
herstellte.
Das
Wirtschaftszentrum der Provinz war Agrippina (Köln). Die dort ansässige
keramische Industrie produzierte nicht nur für den lokalen Markt
sondern auch für den Export. Bereits vor der Stadterhebung im
1.Jh.n.Chr. gab es dort ein grosses und vielfältiges Angebot an
Geschirr und Lampen. Mehr als 20 Öfen waren damals in Betrieb. Die
anfangs noch dominierenden einheimischen Motive wurden mit der Zeit
durch rein römisches Formengut verdrängt. Neben Gebrauchsgütern
produzierte der Keramiksektor auch den Nachschub für einen
ausgedehnten Devotionalienhandel mit kleinen Götterstatuetten. Auch
die Herstellung von Theatermasken aus weissem Pfeifenton ist
gesichert. Die agrippensischen Tonwaren erfreuten sich in der ganzen
Provinz grosser Beliebtheit und im Export gelangten sie hauptsächlich
nach Britannien.
Der
berühmteste Wirtschaftszweig war aber die Glasherstellung. Reiner
Quarzsand wurde westlich von Agrippina (Köln/D) in grossen Mengen
gewonnen. Aufschwung nahm die Industrie mit der Erfindung des
geblasenen Glases, das einige Jahrzehnte v.Chr. wahrscheinlich in
Sidon (im Libanon) erstmals das Licht der Welt erblickte. Sand- und
Tonkerntechnik sowie Formenpressung bei der Glaswarenproduktion traten
ob dieser neuen Technik völlig in den Hintergrund. Zahlreiche
Vitriarii (Glasbläser) brachten besonders seit dem 2.Jh.n.Chr. eigene
künstlerische Kreationen hervor. Nicht nur allerlei Formen und Schnörkel
verzierten die Gläser, sondern auch der Glasschliff fand bereits
Anwendung. Besonders augenscheinlich sind die sog. Diatretgläser,
deren Netzmuster in aufwendigen Verfahren mittels kleiner Schleifrädchen
herausgeschliffen wurden. Dass derartig Filigranes die Zeiten überdauert
hat, grenzt schon an ein Wunder. Exportiert wurden sie in alle
Regionen der Nord- aber auch Ostsee (freies Germanien).
In
Handwerk und Gewerbe war in Untergermanien der Familien- oder
Kleinbetrieb vorherrschend. Bei erhöhter Nachfrage wurden die
bestehenden Betriebe nicht erweitert, sondern es entstanden neue; dafür
nahm die Spezialisierung und Arbeitsteilung zu. Die meisten Arbeiter
waren Freie und keine Sklaven. Letztere waren teuer und deshalb in der
vorherrschenden Produktion nicht wirtschaftlich verwendbar. Auf dem
Land, fernab der Städte herrschte indes Selbstversorgung so gut es
ging.
Collegia (Berufsvereine) gab es zahlreich; nicht nur für produzierende Berufe wie Tignarii (Zimmerleute) oder Tectores (Verputzer), Händler sondern auch für weniger augenscheinliche Professionen wie die der Focarii (Küchenjungen). Als Sitz einer Schiffergilde ist Fectio (Bunnik-Vechten/NL) bekannt. Zu den angeseheneren Berufen gehörten Ärzte, unter denen besonders viele griechische Namen anzutreffen sind, und Scolastici, die sowohl Rhetoriklehrer als auch Rechtsanwälte sein konnten.
Betrachtet man
die Weihealtäre, so dominieren eindeutig die Negotiatores (Händler
& Kaufleute). Ein Zeichen dafür, dass es genug zu handeln gab,
was Gewinn versprach. Ob es sich dabei um lokale oder Fernhändler
handelte lässt sich heute bis auf wenige Ausnahmen kaum mehr
erschliessen. Salben wurden etwa importiert, Wein dürfte lokal bzw.
im angrenzenden Gallien gehandelt worden sein. Aber was ist mit
Sarkophaghändlern? Auch Tonwaren wurden nicht nur lokal erzeugt und
exportiert, sondern auch eingeführt. Manche Händler machten beides.
Sie exportierten niedergermanische Tonwaren und importierten Terra
sigillata aus der Region um Vichy in Gallien.
Die
wichtigsten Märkte ausserhalb der Provinz waren Britannien und das
freie Germanien. So gab es eigene Negotiatores Britanniciani
(Britannienkaufleute). Der Salzhandel war offenbar in Agrippina (Köln)
monopolisiert. Transferhandel dürfte es mit Wein, Salz und
Fischsaucen gegeben haben. Besonders in spätrömischer Zeit er

Kopfgefäss
aus grünem Glas, Köln, 1./2.Jh.n.Chr.
e libro (habe ich mir leider nicht vermerkt...)
Sie wollen Fragen stellen, Anregungen
liefern oder sich beschweren?
Dann klicken Sie auf meine Kontaktseite!
(PL)